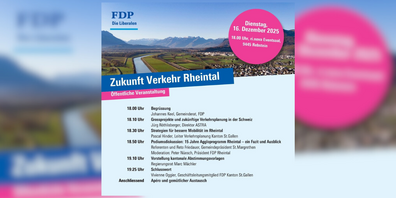Eine kleine Testfrage zum Einstieg: Können Sie spontan zwölf Namen (zehn Prozent von 120 Sitzen) von St.Galler Kantonsrätinnen und Kantonsräten aufzählen? Die wenigsten dürften es schaffen. Das kantonale Parlament kennt man kaum.
Gleiche Frage zum Nationalrat: Wie viele der zwölf Nationalrätinnen und Nationalräte des Kantons St.Gallen kennen Sie mit Namen? Ich würde wetten: Sie bringen sechs Namen zusammen. Damit ist eigentlich alles gesagt.
Das kantonale Parlament spielt in der öffentlichen Wahrnehmung eine untergeordnete Rolle.
Die Politik-Musik spielt heute primär in Bern. Die wichtigen und politisch umstrittenen Themen werden auf Bundesebene behandelt. Die Kantone spielen mehr und mehr eine Statistenrolle: sie vollziehen Bundesrecht. Der kantonale politische Gestaltungsraum ist beschränkt (Steuerhoheit, Schulwesen, kant. Strassenbau etc.) und eben der Vollzug von Bundesrecht.
Dabei sind die Kantone selbst nicht ganz unschuldig: Mehr und mehr Aufgaben werden auf Bundesebene gelöst und die Kantone haben sich selbst in diese Rolle manövriert. Der viel beschworene kantonale Föderalismus wird langsam zum Auslaufmodell. Man mag das bedauern. Aber der Einfluss der kantonalen Politik ist generell gesunken.
Dazu kommt, dass sich der St.Galler Kantonsrat selbst in diese Situation gebracht hat: Der fünftgrösste Kanton leistet sich gerade mal vier Sessionen zu je zweieinhalb Tagen. Im Jahre 2023 strich man gar die April-Session. Vom Februar bis in den Juni gab es keine Session.
Das Parlament überliess Regierung und Verwaltung die Alltagsgeschäfte.
Bei dieser Ausgangslage erstaunt es nicht, dass das öffentliche Interesse an kantonaler Politik kaum existiert. Man wundert sich, dass der Kanton über 400 Stellen in den Spitälern abbauen will, das Parlament schweigt und beschäftigt sich derweil mit drittrangigen Verwaltungsgeschäften. Dazu kommt die mediale Situation im Kanton: Eine kontinuierliche Berichterstattung im klassischen Sinne über kantonale Politik findet heute nicht mehr statt.
Für die Kantonsratswahlen vom 3. März melden 1005 Kandidatinnen und Kandidaten ihr Interesse an. Bemerkenswert hier: Die Zahl ist gegenüber 2020 um 1,1 Prozent gesunken. Ganz anders die Situation bei den NR-Wahlen im Herbst (Rekordwert 5909 Kandidierende).
Das geringe Interesse an der kantonalen Politik zeigt sich auch an einem lauen und langweiligen Wahlkampf.
Da und dort einige Plakate, einige Prospekte im Briefkasten. Das war's dann. Keine kantonalen Themen, die mobilisieren oder interessieren. Bei dieser Ausgangslage erstaunt es nicht, dass die Wahlbeteiligung auch heuer tief sein dürfte. 2020 bemühte sich nicht einmal jeder dritte Wahlberechtigte an die Urne (2020 32,7 Prozent). Was ist nur mit St.Gallen los?
Kontinuität und Stabilität werden dominieren: Nimmt man die Ergebnisse der Parlamentswahlen vom Oktober 2023 als Gradmesser, dürfte sich für die kommenden Wahlen in etwa das gleiche Bild zeigen: Die wählerstärkste Partei SVP kann ihre fünf Sitzverluste von 2020 teilweise kompensieren, die SP legt leicht zu, die Mitte hält ihr Potenzial, FDP, Grüne und GLP müssen mit Verlusten rechnen.
Die SP dürfte am 3. März von den gleichentags stattfindenden Rentenabstimmungen profitieren und auch deshalb zulegen. Unter dem Strich aber kaum grössere Veränderungen in den Blöcken: Die Bürgerlichen behalten eine komfortable Mehrheit.
Was heisst das für die kantonale Politik der nächsten vier Jahre?
Das Parlament muss sich wieder klarer und eigenständiger positionieren. Mehr echte Debatten, mehr Schlagabtausch und mehr kritische Distanz gegenüber Regierung und Verwaltung. Wenn die Regierung im Schnitt drei Monate benötigt, um einen einfachen Vorstoss zu beantworten, dann stimmt etwas nicht. Das neue Parlament muss dafür sorgen, dass Themen, welche die Öffentlichkeit beschäftigen (Spitalplanung, Strassenbau, Wil-West u. a. m.), wirklich auch breit diskutiert werden.
Dazu gehört eine Parlamentsreform, weniger Routinegeschäfte und Verwaltungskram, dafür mehr Zeit für die politische Diskussion. Ein Ringen um Lösungen für den Kanton, ein Bewusstsein auch, dass dieser Kanton nicht nur verwaltet, sondern auch aktiv gestaltet werden will. Das neue Parlament hat es in der Hand, hier Akzente zu setzen, den Kanton auch national besser zu positionieren, weg vom Mittelmass und der beschaulichen Genügsamkeit zu mehr Selbstbewusstsein.
Auf dass St. Gallerinnen und St.Galler spüren: Doch, das Parlament existiert und engagiert sich für einen lebenswerten Kanton.