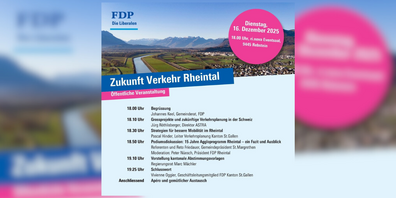Vorsicht, es wird gleich leicht peinlich. Aber keine Sorge, nicht für Sie und mich.
Zunächst die langweiligen Fakten. Am 3. März 2024 werden in St.Gallen der Kantonsrat und die Regierung neu gewählt. Der Kantonsrat bildet das Parlament, auch Legislative genannt. dort sitzen 120 Leute. In der Regierung, der Exekutive, sind 7 Sitze zu vergeben.
Ein gewisses Gedränge auf diese Sitze gibt es in beiden Fällen. Aber ganz so heftig, wie uns das der «Rheintaler» weismachen will, ist dieses nun doch wieder nicht. Mit Blick auf den Wahlkreis Rheintal heisst es dort nämlich wörtlich:
«26 Rheintalerinnen wollen in der Kantonsregierung mitbestimmen.»
Wenn das keine Schlagzeile wert ist: Das dürfte weltweit eine Premiere sein! Es ist ein Vormarsch der weiblichen Sache, wie ihn die Geschichte noch nie gesehen hat. Die vereinigten Feministinnen der Welt verfallen in euphorische Schnappatmung. 26 Frauen, alle allein aus dem Rheintal, setzen zum Kampf um einen der sieben Sitze in der Kantonsregierung an?
Ein Parlament ist keine Regierung
Das klingt spektakulär, fast schon unglaublich – und ist es auch. Es ist nämlich barer Unsinn. Bei den «26 Rheintalerinnen» handelt es sich um Kandidatinnen, die sich in unserem Wahlkreis um einen Sitz im Kantonsrat bewerben, also dem Parlament.
Mit der «Kantonsregierung» hat das in etwa so viel zu tun wie meine Grossmutter selig mit dem Rennen um den Weltfussballer des Jahres – nämlich nichts. Spektakulär an dem Zeitungszitat ist nur eines: wie eklatant falsch es ist. Nein, die 26 Rheintalerinnen wollen nicht «in der Kantonsregierung mitbestimmen». Sie möchten gerne als Kantonsrätinnen an der Gesetzgebung arbeiten. Das mag ähnlich klingen, sind aber zwei ganz verschiedene Dinge.
Man kann diese freundliche Korrektur nun als Rosinenpickerei abtun. Da hat sich eben ein Journalist mal verschrieben und das Parlament mit der Regierung verwechselt – das kann es doch geben?
Natürlich. Aber sollte es das auch geben? Viele Leute tun sich sowieso schon reichlich schwer mit unserem politischen System, der Gewaltenteilung und dem Wahlverfahren. Da hilft es nicht gerade, wenn auch noch die regionale Tageszeitung ein «Chrüsimüsi» veranstaltet. Ausserdem untergräbt es das Vertrauen in den Rest des Geschriebenen leicht, wenn es schon an den grundsätzlichen Begriffen scheitert.
Böse Fake News gegen «seriöse Zeitungen»
Aber nun zur eigentlichen Ironie der Geschichte. Zwei Tage, nachdem uns der «Rheintaler» deutlich gemacht hat, dass er nicht zwischen Regierung und Parlament unterscheiden mag (oder kann), liest Stefan Schmid, der Chefredaktor des «St.Galler Tagblatts», von dem der «Rheintaler» die überregionalen Inhalte bezieht, uns Medienkonsumenten die Leviten.
Der Chefredaktor beklagt eine «Informationskrise». Denn immer mehr junge Leute schauen sich lieber Videos auf «TikTok» an, statt seine Zeitung zu lesen. Damit, so die These, würden sie Opfer von Propaganda, statt «Aufklärung» zu geniessen. Sein aufrüttelnder Befund: «Fake News» aus dubiosen Quellen geraten ungefiltert an unseren unschuldigen Mediennachwuchs, und dieser ist zugleich einfach nicht bereit, Geld für eine seine Zeitung auszugeben.
Da leidet der Kopf einer Zeitungsredaktion offensichtlich unter einer schwindsüchtigen Auflage und weint sich nun aus. Gleichzeitig zeigt er aber den Weg aus der Misere auf: «Abhilfe schaffen seriöse, klassische Medien, gerade auch regionale und lokale». Womit er natürlich exklusiv die eigenen meint, für die man tief in die Tasche greifen muss.
Mit Verlaub: Solange diese «seriösen, klassischen Medien» nicht einmal wissen, wer in der Schweiz die Gesetze macht und wer sie umsetzt, wer Parlament und wer Regierung ist, fällt es etwas schwer, diesen eindringlichen Aufruf ernst zu nehmen. Wir sprechen hier von Stoff aus der ersten Oberstufe des obligatorischen Unterrichts.
Das durchaus verzeihliche Einzelbeispiel soll an dieser Stelle nur eines aufzeigen: Es ist gefährlich, sich selbst als «Qualitätsmedium» aufzuspielen und allen anderen entweder böse Absichten oder Unfähigkeit zu unterstellen. Denn an dieser Eigendarstellung wird man danach auch gemessen. Und dann muss man sich, pardon, verdammt viel Mühe geben, bis alle Fakten stimmen.